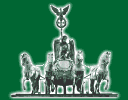
Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie demnächst an einem armen Kerl vorbeikommen, der seinen ganzen Besitz in einem Einkaufswagen vor sich her schiebt, oder an einem Flohmarktstand, auf dem ein Kind seine gesamten Diddl-Schätze feilbietet, so sprechen Sie bloß nicht in despektierlichem Ton. Sie könnten es nämlich mit dem schönsten Wort der Deutschen zu tun haben.
Denn es ist gefunden, das sprachliche Äquivalent zu Adenauer, dem "größten Deutschen". Seit Mai suchte Deutschland, respektive der für die Förderung der Sprachsensibilität sich zuständig fühlende Deutsche Sprachrat, das Superwort, das "liebste, schönste, kostbarste deutsche Wort". Eine Reise nach Mauritius war zu gewinnen. Und nun ist es von einer Jury, in der so ausgefuchste Sprachkünstler wie Christian Kracht, Volker Finke und Herbert Grönemeyer und so prominente Sprachsachverständige wie die Deutschlandradio-(!)-Programmdirektorin Gerda Hollunder, der Deutsche-Welle-Intendant Erik Bettermann und der Filmregisseur Joseph Vilsmayer vertreten waren, gekürt worden: "Habseligkeiten".
Das Lieblingswort der Deutschen wurde mithin nicht gekürt. Denn "Habseligkeiten" hatte es in der Rangliste der 22 838 eingesandten Vokabeln nicht unter die am meisten genannten zehn geschafft. Die Spitzengruppe (in der sich weder "Sprachrat" noch "Sprachsensibilität" findet) bildet einen fürs Deutsche und die Deutschen typischen Kanon der üblichen Verdächtigen: "Liebe", "Gemütlichkeit", "Sehnsucht", "Heimat", "Kindergarten", "Freiheit".
Sehr deutsch ist das laut Kluges Etymologischem Wörterbuch seit dem 17. Jahrhundert bezeugte, auf ein verlorengegangenes Adjektiv "habselig" verweisende Wort "Habseligkeiten" (Duden: dürftiger, kümmerlicher Besitz, der aus meist wenigen [wertlosen] Dingen besteht) nun aber doch. Denn es steckt mit den ersten drei Buchstaben tief in der Scholle der Sehnsüchte des irdischen Alltags und mit den folgenden fünf im Himmel der Sehnsüchte nach spirituellem Glück. Und dazwischen irrt gerade der Deutsche ja gern hin und her, er kann nicht anders.
Sehr deutsch ist "Habseligkeiten" allerdings auch lexikalisch. Denn es verweist auf eine Stärke der deutschen Sprache, die gleichzeitig eine Schwäche ist. Nach den ersten acht Lettern stürzt das schöne Wort nämlich tief in den Sumpf der deutschen Substantivitis, die häufig zu uneleganten und inhaltlich unscharfen Konstruktionen führt. Und Substantive, die mit "-keit" gebildet werden, sollte man aufgrund ihres besonders häßlichen und kalten Schlußklangs außer zur Reimbildung eher selten verwenden.
Einsenderin Doris Kalka ist das egal. Sie argumentiert - das ist die große Schwäche des ganzen Wettbewerbs - inhaltlich und ist natürlich begeistert. Sie verweist auf die Subtilität, auf das Mitleid, das mitschwingt in diesem Wort, dem spärlichen Besitz dessen gegenüber, "der sein Zuhause verliert und sein karges Hab und Gut für alle sichtbar transportieren muß", und sie findet, fabulierte sie in ihrer nun prämierten, pastoralen Laudatio auf "Habseligkeiten" weiter: "Wo sonst der Weg zum spirituellen Glück, zur Seligkeit also, eher in der Abwendung von weltlichen Gütern oder doch zumindest in der inneren Loslösung aus der Abhängigkeit von Weltlichem gesehen wird, so fassen wir hier die Liebe zu Dingen, allerdings zu den kleinen, den wertlosen Dingen auf als Voraussetzung zum Glück."
Vielleicht sollte man sich hüten, allzu steile Thesen aus dem Ergebnis dieses Superstar-Castings der besonderen Art zu entwickeln. Ohne Fisimatenten (auch sehr schön!) haben die Einsender aus Polen "Vergißmeinnicht" an die Spitze ihrer Hitliste gesetzt. Und die Niederländer mögen vor allem "Fingerspitzengefühl". Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.